
Seit 2017 präsentiert die Website der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Informationen und Materialien zur Kommunismusgeschichte. 2023 wurden die Inhalte der Seite erweitert und das Seitenlayout überarbeitet.
Die Besonderheit der Website:
kommunismusgeschichte.de verfügt über ein zentrales Suchfeld im oberen Bereich der Seite, das dem Nutzer auf der Startseite eine freie Suche ermöglicht, deren wichtigste Ergebnisse nach Relevanz sortiert, jeweils übersichtlich für alle Rubriken dargestellt werden. Darüber hinaus kann der Nutzer auch gezielt in den einzelnen 8 Kategorien und weiteren Unterkategorien suchen.
Die Website kommunismusgeschichte.de stellt verschiedenste Inhalte vor:
Hier finden sich News, Bücher, Websites, Ausstellungen, Gedenkorte, Opferinitiativen, Filme, Lexika, Rezensionen, Podcasts, Veranstaltungen und Quellen zur Geschichte des Kommunismus. Alle Inhalte werden in einem kurzen Text erläutert und vorgestellt. Zu den einzelnen Inhalten gibt es Fotos, Filme, Podcasts, weiterführende Links und teils eine kartografische Verortung. Der User bekommt einen ersten Eindruck vom Inhalt und kann sich dann gezielt weiter informieren.
Die Website kommunismusgeschichte.de ist Lotse in der Forschungslandschaft, sie leitet und lenkt mit ihrer Suchfunktion zu über 1000 Einzeleinträgen, die Licht in die Geschichte des Kommunismus bringen und kontinuierlich erweitert werden. Die Kategorie „Aktuelles“ bündelt News, Veranstaltungen und Onlinepresse, unter „Lesen“ finden sie nicht nur Hinweise auf Bücher und Rezensionen zum Thema, sondern seit 2023 auch vergriffene Standardwerke als E-Books, „Sehen“ bietet Filmmaterial, Spielfilme, Dokus sowie Videopodcasts der Stiftung. Unter „Hören“ verbirgt sich unser Podcast Kanal, in der Kategorie „Lernen“ finden sich Ausstellungen, Museen und Bildungsmaterialien, „Forschen“ bündelt viele Forschungseinrichtungen und Portale. In der Kategorie BioLex werden über 5500 Biografien aus drei Lexika zugänglich gemacht. Unter JHK sind die retrodigitalisierten Beiträge des Jahrbuchs für Historische Kommunismusforschung von 1993 bis 2023 zu finden. Im JHK werden jährlich unter einem thematischen Schwerpunkt Aufsätze von Experten und Expertinnen der Kommunismusforschung publiziert. Wer an der Ereignisgeschichte interessiert ist, findet unter „Chronik“ in einer illustrierten Zeitleiste Schlaglichter auf die Geschichte des Internationalen Kommunismus im 20. Jahrhundert. Die interaktive Karte bietet dem Nutzer über eine Filterfunktion die Möglichkeit, bestimmte Inhalte der Website geografisch zu verorten.
Eine Suche, acht Kategorien, zahlreiche Ergebnisse. Die Website bietet viele Anregungen für Wissenschaftler, Mittler der historisch-politischen Bildung, Studierende, Lehrer und Journalisten.
Wenn wir auf dieser Seite nicht durchgängig geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwenden, so tun wir dies aus Gründen der Verständlichkeit und Barrierefreiheit. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es uns fernliegt, damit einzelne Personengruppen auszuschließen.
Aktuelles
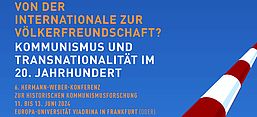
Konferenz
Kommunismus und Transnationalität im 20. Jahrhundert
vom 11.06.2024 | bis zum 13.06.2024nzz
Das Kondom als Element bürgerlicher Zersetzung: Die Russen und ihre Kultur der Familienplanung
vom 25.04.2024 | nzztaz
Emotionaler Zwist um Titos Grabstätte
vom 10.04.2024 | taznd
Lenin: Er wurde gerühmt und verdammt
vom 14.02.2024 | ndJHK
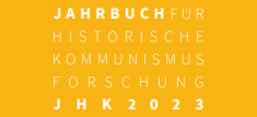
JHK 2023
Wahrheit und Lüge nach dem Terror
Anna Schor-TschudnowskajaJHK 2023
Kern und Peripherie. Zur Struktur politischer Tabus in der DDR
Udo GrashoffJHK 2023
Die Staatsanwaltschaft und die Steuerung der politischen Justiz in der DDR
Christian BooßJHK 2023
Tschekismus im Sinkflug
Jens GiesekeLesen
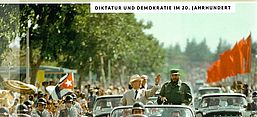
Fachbuch
DDR-Sozialismus in der Karibik? Die ostdeutsche Kuba-Politik zwischen 1959 und 1989
Antonia BihlmayerFachbuch
Maoismus. Eine Weltgeschichte
Julia LovellRezension
LiesMich! Kurzrezensionen für Kommunismusgeschichte.de
Lexikon | Website
Biografisches Lexikon Widerstand und Opposition im Kommunismus 1945-91
Hören

Veranstaltungsmitschnitt
Geteilte Erinnerung: Das kurze Leben des Philipp Müller
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-DiktaturVeranstaltungsmitschnitt
Auf dem linken Auge blind? Der Umgang mit dem Kommunismus im vereinten ...
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-DiktaturVeranstaltungsmitschnitt
DDR-Tourismus – Reisen in Grenzen
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-DiktaturVeranstaltungsmitschnitt
Die Oktoberrevolution als Projektionsfläche von Verschwörungstheorien
vom 11.05.2016 | Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-DiktaturForschen

Forschungsinstitut
Institut zur Erforschung des Kommunismus (Kommunizmuskutató Intézet igazgatója)
Scholarship
Visegrad Scholarship at the Open Society Archives
Tagung
CfP: Von der Internationale zur Völkerfreundschaft? Kommunismus und Transnationalität im 20. Jahrhundert
Marcel Bois, Christian Dietrich, Rhena Stürmer | vom 13.04.2023 | bis zum 14.06.2024Online-Ressource
Online collections of Polish cultural and scientific institutions
Lernen

App | Führung
Der Matrosenaufstand 1918
Opferverband | Dachverband
Internationale Assoziation ehemaliger politischer Gefangener und Opfer des Kommunismus (Inter-Asso)
Artikel | Debatte
Russland: Kinderfreizeit im Internierungslager?
Juri ReschetoDidaktisches Material | Website
REUNIFICATION REVISITED
vom 01.12.2020 | bis zum 10.12.2020

